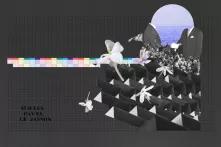Von Tunesien bis Bahrain: Das Jahr 2011 markierte eine Zäsur in Nahost und Nordafrika. Mit unglaublichem Mut erhoben sich Millionen Frauen und Männer gegen Herrscher, deren Macht innenpolitisch auf Gewalt und außenpolitisch auf westlicher Bequemlichkeit beruhte.

Obwohl die USA und Europa sich zu Demokratie und Menschenrechten bekennen, haben sie sich zumeist trefflich mit den Autokraten des Nahen Ostens arrangiert. Im Amt verknöchert regierten diese allerdings immer mehr an den Bedürfnissen der Bürger/innen vorbei. Junge Menschen sahen kaum Zukunftschancen für sich, auch weil immer offensichtlicher wurde, wie ungleich Ressourcen verteilt wurden.
Doch sozioökonomische Forderungen standen in keinem der Aufstände an erster Stelle. Stattdessen: Würde. In den postkolonialen Bürokratien in Nahost und Nordafrika zu leben, bedeutete ständig erniedrigt zu werden. Der kleinste Gang zur Behörde war ein Spießrutenlauf, die bestechliche Polizei regelte weit mehr als den Straßenverkehr. Herkunft und Vermögen entschieden über Zugang zu Bildungs- und Gesundheitssystemen. Jahrzehnte lang führten die Geheimdienste ein brutales Eigenleben im Auftrag der jeweiligen Regimen. Mit Folter, erzwungenem Verschwindenlassen und sexualisierter Gewalt griffen sie nicht nur die körperliche Unversehrtheit, sondern ganz bewusst auch die Würde der Bürger/innen an.
In ethnisch und konfessionell vielfältigen Gesellschaften vereinnahmten die Machthaber zudem einzelne Bevölkerungsgruppen, säten Misstrauen und spalteten ihre Gesellschaften. Auch gegen diese Form der Entwürdigung und Erniedrigung richteten sich die Proteste von 2010/2011. Bezeichnungen wie „Arabischer Frühling“ oder „Arabellion“ beschreiben insofern nur einen Teil des Geschehens. Auch viele, die sich nicht als „arabisch“ definieren, riskierten alles für Veränderungen: Iraner/innen, Kurd/innen, Jesid/innen, Armenier/innen, Amazigh, und Staatenlose, um nur einige zu nennen.
Das Aufbegehren ging einher mit einer kulturellen Blüte. Revolutionäre Lieder und Slogans sprangen von einem Land zum anderen über, zentrale Figuren und Momente der jeweiligen Revolutionen wurden in Streetart und Graffiti verewigt und online geteilt. Mit ganz anderen Augen sahen Aktivist/innen aus der Region einander. Die unglaubliche Ausstrahlung der kreativen Methoden ihres Widerstands beeindruckten viele auch außerhalb der Region.
Ihre großen Ziele haben die Aufstände indes bislang nicht erreicht.
Einzig in Tunesien bedeutete das Abdanken des langjährigen Machthabers Zine el-Abedine Ben Ali auch den Übergang zur Demokratie und einer neuen Verfassung. Doch die Errungenschaften müssen täglich aufs Neue verteidigt, die Fortschritte bei Frauenrechten gegen die immer noch starken konservativen Kräfte mühsam durchgesetzt werden.
Ägypten, in dem nach 18 Tagen des Protestes der langjährige Präsident Hosni Mubarak abgesetzt wurde, gab vielen anderen Hoffnung, dass auch in ihren jeweiligen Kontexten Wandel möglich sei. Doch das Militär blieb im Sattel und das Land glitt unter dem gewählten Präsidenten Mohammed Mursi zunehmend ins Chaos ab. Dabei war es auch die internationale Unterstützung für eine „geordnete Transition“, die dem Putsch Abdel Fattah al-Sisis im Sommer 2013 den Weg ebnete. Seither gibt es weit mehr politische Gefangene und die Todesstrafe wird häufiger verhängt als unter dem bis 2011 herrschenden Mubarak.
So inspirierend die Aufstände für viele waren, so interessiert lernten die Regime aus den „Fehlern“ der anderen. Das Herrscherhaus in Marokko wendete größere Proteste mittels Reformen ab, verfolgt seither aber Dissident/innen, Journalist/innen und kritische Kreative umso härter. Die iranische Führung schlug die immer wieder aufflackernden Proteste im eigenen Land stets mit harter Hand nieder und setzte auch im Irak die mit ihnen verbündeten Hashte Shaabi gegen Demonstrant/innen ein.
Die derzeitigen Abgesänge auf die „gescheiterten“ Revolutionen vernachlässigen, dass Revolutionen selten geradlinig verlaufen und es deswegen verfrüht ist, ihren „Erfolg“ bereits nach zehn Jahren abschließendes zu beurteilen. Doch in ihnen hallt auch das tradierte Klischee wider, dass es „den Menschen in der arabischen Welt“ an Reife für die Demokratie fehle. Westliche Staaten haben demokratischen Akteuren der Region wenig zugetraut und sie folglich nicht genügend unterstützt.
Nicht die Aufständischen haben zu wenig gewagt, sondern die Mächtigen hatten zu wenig zu fürchten.
Dabei entlarvten die Proteste von 2010/2011 und ihre Folgen den Mythos von Diktatoren als „Garanten der Stabilität“. In Syrien beweist Bashar al-Assad, dass er das Land lieber in Schutt und Asche legt als von der Macht zu lassen, unterstützt durch Iran und Russland. In Libyen und Jemen droht der Staatszerfall nicht nur wegen innenpolitischer Auseinandersetzungen in Folge der Umstürze, sondern weil undemokratische externe Mächte ihre eigenen Interessen verfolgen – auf Kosten der Bevölkerung und der Stabilität.
Dass sich die USA unter Barack Obama zunächst von transatlantischen Beziehungen und unter Donald Trump dann vom Multilateralismus abgewendet haben, schwächt internationale Normen. Niemand hindert Russland und andere Antidemokraten daran, immer unverblümter ein Recht des Stärkeren durchzusetzen. Iran, die Golfstaaten und die Türkei greifen regional auch jenseits ihrer direkten Nachbarstaaten militärisch ein, nicht nur durch traditionelle oder neue Verbündete, sondern auch mit Söldnern. Demokratische Staaten setzen den offensiver auftretenden autoritären Allianzen immer weniger entgegen. Daher sind demokratische Kräfte in den meisten Ländern der Region die Defensive geraten. Hunderttausende haben ihren Drang nach Würde und Freiheit mit dem Leben bezahlt.
Und doch wähnen sich die Autokraten längst nicht mehr sicher. Sie haben ihre Unantastbarkeit gegenüber ihrer eigenen Bevölkerung verloren. Genau diese Paranoia veranlasst die Herrschenden zu umso gewalttätiger gegen jegliche Form des vermuteten Widerstands vorzugehen – aber die alte Friedhofsruhe ist trotzdem vorbei. Auch dank der neuen medialen Möglichkeiten verstummen viele Menschen nicht mehr, sondern führen von unterschiedlichen Orten die Debatten weiter, die vorher selbst im engsten Familien- oder Freundeskreis kaum möglich waren und doch für neuen Staats- und Regierungsformen unabdingbar sind: um Rechte und Gleichberechtigung, um politische Vorstellungen, um Selbstbestimmung und Mitbestimmung.
Anlässlich der Jahrestage schildern uns Autor/innen aus verschiedensten Kontexten, was sie hoffen, wovon sie träumen, was sie sich fragen und woran sie zweifeln. In ihren literarischen Essays wird deutlich, wie wichtig die persönlichen Auseinandersetzungen sind, um politische Alternativen zu entwickeln, und was jenseits der großen Ziele erreicht wurde.