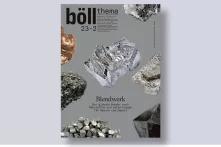Das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen ist gespickt mit Verpflichtungen zur "Wertschöpfung" in den Ländern, in denen kritische Mineralien abgebaut und verarbeitet werden sollen. Es besteht jedoch Grund zur Annahme, dass die Definition von "Wert" die enormen sozialen und ökologischen Kosten dieser Aktivitäten nicht einschließt.

Eine Fabrik mag wirtschaftlich wertvoll erscheinen, aber wenn sie die Umwelt so stark verschmutzt, dass sie das umliegende Ökosystem zerstört, ist sie nicht wertschöpfend. Diese Erkenntnis sollte im Mittelpunkt politischer Entscheidungen der Europäischen Union im Wettlauf um die Sicherung des Zugangs zu 34 Rohstoffen stehen, die als "kritisch" für die Sektoren erneuerbare Energien, Digitaltechnik, Raumfahrt und Verteidigung sowie Gesundheit in der EU gelten.
Der Gewinnungsprozess kritischer Mineralien aus Roherz – noch vor dem Schmelzen, Raffinieren oder der anderweitigen Umwandlung in eine nutzbare Form – in den globalen Lieferketten ist stark auf Länder außerhalb Europas konzentriert. Im Jahr 2021 verarbeitete China 50 Prozent des weltweiten Lithiums, 56 Prozent des Nickels, 80 Prozent des Galliums, 60Prozent des Germaniums und 69 Prozent des Kobalts. Infolgedessen entstehen in diesen Lieferketten häufig Engpässe und sie reagieren äußerst empfindlich auf wirtschaftliche und geopolitische Schocks. Wenn eine mineralverarbeitende Macht wie China beschließt, die Versorgung mit kritischen Mineralien als Druckmittel oder zur Bestrafung einzusetzen, hat die EU einen erheblichen Nachteil. Im Juli 2023 kündigte China an, die Ausfuhr von Gallium und Germanium zu beschränken, die beide für die Herstellung von Halbleitern benötigt werden. Diese Entscheidung hatte Auswirkungen auf die nationale Sicherheit in Europa, wo die Nachfrage nach Gallium bis 2050 voraussichtlich um das 17-fache steigen wird.
Diese Anfälligkeit erklärt zum Teil, warum die Europäische Kommission das Gesetz zu kritischen Rohstoffen (Critical Raw Materials Act) bis Anfang 2024 verabschieden will. Neben der Stärkung der eigenen Kapazitäten zur Rohstoffverarbeitung in der EU und dem Aufbau "strategischer Partnerschaften" mit rohstoffreichen Ländern ist das Gesetz ein Schlüsselelement der EU-Strategie zur Sicherung der von ihr benötigten Rohstoffe.
Um die Attraktivität strategischer Partnerschaften zu steigern – und sich gleichzeitig von ihrer extraktivistischen Vergangenheit zu distanzieren – hat die EU in das Gesetz Verpflichtungen zur "Wertschöpfung" in den Ländern aufgenommen, in denen kritische Rohmineralien abgebaut und verarbeitet werden sollen. Wir können zwar erahnen, was damit gemeint sein könnte - zum Beispiel Unterstützung bei der Entwicklung von Kapazitäten zur Mineralverarbeitung in Ländern, wo diese fehlen - aber weder das Gesetz selbst noch andere bisher veröffentlichte Dokumente definieren eindeutig, wie die Wertschöpfung gemessen werden soll.
Wie eine neue Studie der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt, können daher weder die Bürger*innen der Minerale abbauenden Länder noch die Europäer*innen sachkundige Entscheidungen über diese strategische Partnerschaften treffen, die übrigens ohnehin nicht rechtlich bindend sind. Ein in der Studie befragter Experte weist darauf hin, dass „Wertschöpfung zu einem politischen Schlagwort wird, wenn es keine klare Definition dafür gibt. Damit das Konzept in der Praxis Bedeutung erlangt, muss seine Bedeutung erst entschlüsselt werden."
Die Europäische Kommission hat einige Hinweise geliefert, was von einer solchen "Entschlüsseln" zu erwarten sein wird. Während der EU-Rohstoffwoche in Brüssel im November 2023 deuteten öffentliche Erklärungen von Kommissionsvertreter*innen darauf hin, dass Wertschöpfung vorrangig wirtschaftlicher interpretiert wird, mit Blick auf die Entstehung von Arbeitsplätzen und Einnahmen für die Gemeinden vor Ort. Arbeitsplätze und Einnahmen sind natürlich wünschenswert, dieser Ansatz berücksichtigt aber nicht die enormen ökologischen und sozialen Kosten der Verarbeitung von Mineralien.
Profitiert die lokale Wirtschaft wirklich von Aktivitäten, die ihr wichtige ökologische und soziale Ressourcen entziehen?
In Namibia hat ein großer Kupferschmelzbetrieb in Tsumeb in der Vergangenheit die Luft, den Boden und das Wasser so stark verschmutzt, dass bei den Anwohner*innen erhöhte Blei- und Arsenkonzentrationen festgestellt wurden. In Chile hat die Lithiumgewinnung zu erheblichem Wassermangel geführt, da sie 65% der Wasservorräte der Atacama-Wüste verbraucht und die Süßwasserquellen verseucht. Die örtlichen Gemeinden wurden zu diesen Aktivitäten kaum oder gar nicht konsultiert - ein Verstoß gegen die Grundsätze des Übereinkommens 169 der Internationalen Arbeitsorganisation und der UN-Deklaration über die Rechte der Indigenen Völker.
Wenn man die örtliche Bevölkerung vergiftet, um Arbeitsplätze für sie zu schaffen, können diese Arbeitsplätze dann wirklich als "Wertschöpfung" betrachtet werden? Was ist mit den Einnahmen aus den Bodenschätzen, ermöglicht durch die Zerstörung der lokalen Ökosysteme? Profitiert die lokale Wirtschaft wirklich von Aktivitäten, die ihr wichtige ökologische und soziale Ressourcen entziehen?
Es sollte offensichtlich sein, dass kurzfristige wirtschaftliche Gewinne durch den Abbau und die Verarbeitung von Mineralien wenig nützen, wenn sie verheerende Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit haben (die natürlich längerfristige wirtschaftliche Kosten verursachen). Aus diesem Grund muss die Europäische Kommission ökologische und soziale Auswirkungen in die Bewertung von Wertschöpfung im Gesetz zu kritischen Rohstoffen und ähnlichen Initiativen einbeziehen.
Aber das ist nur der Anfang. Selbst aus rein wirtschaftlicher Sicht erfordert das Konzept der Wertschöpfung eine differenziertere Sichtweise. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht wurde berechnet, dass mehr als 95 % des BIP, das durch die verstärkte Nickelverarbeitung in einer der beiden wichtigsten nickelproduzierenden Regionen Indonesiens, Morowali, erwirtschaftet wurde, nicht dort verblieb. Die lokalen Gemeinden tragen also nicht nur die massiven Umweltkosten des Nickelabbaus, sie profitieren auch kaum von den Einnahmen. Solche Zustände sollten von der EU nicht als "Wertschöpfung" betrachtet werden.
Die Investitionen der EU werden lediglich die Fehler des derzeitigen fossilen Systems fortsetzen.
Und dann ist da noch best practice, also das bestmögliche Vorgehen. Verfahren zur Verarbeitung von Mineralien sind im Vergleich beispielsweise zum Bergbau relativ wenig auf ihre vielfältigen Auswirkungen untersucht. Expert*innen sehen die "grüne" Veredelung - falls es so etwas überhaupt geben kann - bestenfalls als ein sich neu entwickelndes Feld. Bisher haben sich die Fortschritte in der Verarbeitung vor allem auf die Minderung finanzieller und geopolitischer Risiken für Unternehmen konzentriert, nicht auf die Verbesserung der sozialen und ökologischen Dimensionen.
Zwar behauptet der Elektrofahrzeughersteller Tesla, eine "innovative" Lithiumverarbeitungstechnik entwickelt zu haben, die "weniger gefährliche Reagenzien verbrauche“ als das herkömmliche Verfahren und "brauchbare" Nebenprodukte erzeuge. "Man könnte mitten in einer Raffinerie wohnen und hätte keine negativen Auswirkungen", prahlt Tesla-Chef Elon Musk. Details hat das Unternehmen jedoch bisher keine veröffentlicht. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat Tesla um weitere Informationen gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.
In ihrer aktuellen Praxis kann die Verarbeitung von Mineralien in einigen Fällen einen gewissen wirtschaftlichen Mehrwert für manche Länder bringen, jedoch zu hohen sozialen und ökologischen Kosten. Solange die EU nicht die eng an wirtschaftliche Erwartungen geknüpfte Maßstäbe erweitert, werden ihre Investitionen in diesem Sektor lediglich die Fehler des derzeitigen fossilen Systems fortsetzen und dabei die Gesundheit von Menschen schädigen, Ökosysteme zerstören und die "Dekarbonisierungskluft" verschärfen. Keine noch so große Rhetorik über "Wertschöpfung" wird das ändern.
Dieser Artikel erschien zuerst auf Project Syndicate.